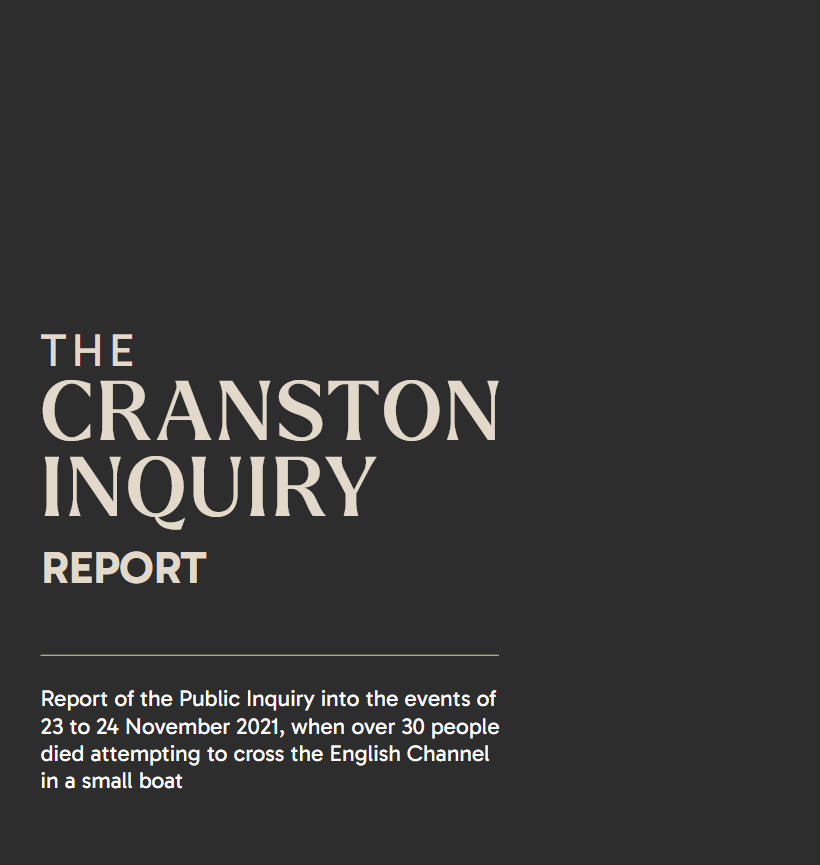
Seit dem 5. Februar 2026 liegt der Abschlussbericht der Kommission vor, die unter der Leitung des britischen Jura-Professors Ross Cranston die bislang schlimmste Katastrophe der Kanalroute untersuchte. Das über 450seitige Dokument beschreibt eine Verkettung von Unzulänglichkeiten und Überforderungen, Fehleinschätzungen und Fahrlässigkeiten, die in der Nacht vom 23. auf den 24. November 2021 vermutlich 31 Menschen das Leben kostete. Der Bericht ist ein Meilenstein in der Aufarbeitung dieser tödlichen Dimension der Grenzpolitik, und dennoch bleiben Fragen.
Bereits in den Tagen nach der tödlichen Havarie wiesen die Aussagen der beiden Überlebenden auf ein unfassbares Versagen der Rettungsleitstellen beiderseits des Ärmelkanals hin (siehe hier und hier). Bis heute laufen strafrechtliche Ermittlungen gegen das Personal der französischen Leitstelle CROSS Gris-Nez, und mehrfach zeigten offizielle Untersuchungen und investigative Medien gravierende Fehler auf. Im Kern geht es dabei um die Frage, warum wiederholte Notrufe der Passagier:innen nicht zu einer Rettung führten, sodass fast alle starben. Erst einen halben Tag nach der Havarie wurden die Leichen von 27 Menschen entdeckt, vier weitere sind seither verschollen.
Die Cranston Inquiry, deren Ergebnisse nun vorliegen, begann vor einem knappen Jahr, im März 2025, mit der Befragung eines der beiden Überlebenden; es folgte das verantwortlichen Personal auf britischer Seite, während die französische Seite fehlte und entsprechende Fragen nicht geklärt werden konnten. Der nun veröffentlichte Abschlussbericht ist das wohl umfangreichste Dokument, das je über eine tödliche Havarie auf der Kanalroute und über das Verhalten und Versagen genau jener Institutionen erarbeitet wurde, die hätten retten müssen und können.
Der Bericht untersucht zunächst die Strukturen und Ressourcen, die der britischen Rettungsleitstelle in Dover und der mit ihr zusammenwirkenden staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen zur Verfügung standen. Bereits auf dieser allgemeinen Ebene benennt er zahlreiche Defizite, die häufig mit unzureichender Kommunikation und Datenerfassung, mit personeller Unterbesetzung, mangelnder Qualifikation, fehlender Supervision, hohem Stress und mentaler Überlastung, aber auch mit der mangenden Implementierung und Einübung etablierter Methoden für Search and Rescue-Operationen bei Flüchtlingsbooten zu tun haben. Um Notrufe von Geflüchteten anzunehmen, waren beispielsweise ein Handy und ein Übersetzungstool angeschafft worden, doch waren Mitarbeitende nicht ausreichend mit der Handhabung vertraut; es bestanden Sprachbarrieren und Probleme bei der Ermittlung von Positionsdaten. In Ermangelung adäquater Trainings entstanden improvisierte Routinen und informelle Regeln. So galt es unter Mitarbeitenden als ausgemacht, dass Geflüchtete in Seenot dazu neigten, ihre Situation übertrieben darzustellen. Auch in der Todesnacht spielte dies offenbar eine Rolle.
Der Bericht lässt keinen Zweifel daran, dass diese Defizite systemischer Natur waren und in der Nacht zum 24. November 2021 zu massiven Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen führten. Zwar wurde die Mayday-Situation des incident Charlie, wie das havarierte Boot im internen Dokumentationssystem der Leitstelle hieß, durchaus festgestellt, doch unterblieb die genaue Lokalisierung des Bootes. Die Nachtschicht der ohnehin unterbesetzten Leitstelle bestand aus lediglich drei Personen, von denen zwei Auszubildende waren. Der Schichtleiter entschied, seine französischen Kollegen zu benachrichtigen, deren Rettungsschiff Flamant sich in der Nähe des Seegebiets befand, wo das havarierte Boot vermutet wurden. Doch die Flamant führte die Rettung nicht durch. Weil die Flamant jedoch einen anderen Rettungseinsatz durchführte, glaubte man in Dover, der incident Charlie sei beendet, dokumentierte dies jedoch nicht und teilte die zu Grunde liegenden Informationen später nicht mit der Tagschicht. Als weder die Flamant noch ein inzwischen eingesetzter britischer Hubschrauber ein sinkendes Boot meldeten und die Notrufe versiegten, wurde der incident Charlie als beendet betrachtet, aber nicht als beendet dokumentiert, und auch nicht in Erwägung gezogen, dass das Boot vollständig gesunken und die Menschen gestorben sein könnten. Aus der Befragung des Hubschrauberpiloten ergab sich, dass dieser eine Chance gehabt hätte, das Boot zu finden, hätte er über genauere Informationen verfügt und deshalb engmaschiger gesucht.
Diese und zahlreiche weitere Erkenntnisse der Cranston Inquiry belegen ein systemisches Versagen, dem ein 18 Punkte umfassender Katalog zur Verbesserung der Such- und Rettungskapazitäten gegenübergestellt ist. Doch trifft der Bericht auch eine zentrale politische Feststellung. Denn er verweist darauf, dass die Zunahme der Bootspassagen in den Jahren 2020/21 von den politischen Entscheidungsträger:innen vorrangig als ein Problem der Grenzsicherheit wahrgenommen wurden. Investiert wurde in Abschottung, und die notwendige Vorbereitung auf absehbare Such- und Rettungseinsätze unterblieb.