
Die britische Politik gegenüber den small boats im Ärmelkanal durchläuft eine Veränderung. Diese vollzieht sich auf mehreren Handlungsebenen und weist zwei scheinbar entgegengesetzte Enwicklungslinien auf: Während einerseits neue multilaterale Formate unter Einbeziehung Deutschlands entstehen, tritt andererseits ein Primat des Nationalen hervor, das die Vielzahl einzelner Praktiken und Vorhaben ideologisch überwölbt. Die Post-Brexit-Grenzpolitik scheint sich in ihrer Radikalität den Grenzpolitiken von Staaten wie Ungarn, Italien oder Polen anzunähern. Dabei inszenieren sich britische Konservative mit eigenständigen Ideen als Avantgarde einer neuen internationalen Flüchtlingspolitik. Ob dies gelingen kann, ist alles andere als ausgemacht. In einer losen Folge von Beiträgen werden wir an dieser Stelle einige Dimensionen dieser Post-Brexit-Grenzpolitik ausleuchten. Wir beginnen mit einen Überblick.
Top-Priorisierung der Schlauchboote

Zu Beginn des Jahres 2023 wertete der konservative Premierminister Rishi Sunak die Bekämpfung der small boats im Ärmelkanal zu einer der fünf Prioritäten seiner Regierung aus. Eine Grafik (s. o.) der Regierung zeigt dieses Thema gleichrangig mit zentralen Politikfeldern der Wirtschafts-, Finanz- und Gesundheitspolitik: Die Grenze wird, wenn auch nur als fünfter von fünf Punkten, in das Zentrum des politischen Handelns gerückt. Offen ist zunächst, was nun zu erwarten ist: Eine heftige antimigrantische Kampagne voller alarmistischer Rhetorik und aktionistischer Vorstöße? Oder eine weitere Verschärfung des Grenz- und Migrationsregimes, die sich in tatsächlichen rechtlichen, strukturellen und institutionellen Veränderungen niederschlägt? Nach Lage der Dinge ist beides zu erwarten.
Am 13. Dezember 2022 und 4. Januar 2023 stellte Sunak dem Parlament seine Absichten vor. Dazu gehört die Einrichtung eines „neuen, ständigen, einheitlichen Einsatzkommandos für die kleinen Boote“. Dieses Small Boats Operational Command soll alle verfügbaren technischen Hilfsmittel einsetzen und Aufklärung, Abfangen und Bearbeitung bezüglich der Boote bündeln. In dem Zentrum sollen das Militär und die zivile National Crime Agency (NCA) zusammenarbeiten. Die NCA soll zusätzliche Mittel zur Bekämpfung der Migration erhalten.
Dies ist nicht grundlegend neu. Ein Kommandeur für Operationen gegen Bootspassagen wurde bereits 2020 ernannt, militärische Ressourcen werden seit 2019 in die Bekämpfung der Migration auf der Kanalroute einbezogen und im März wurde die Gesamtverantwortung unter dem Namen Operation Isotrope auf das Militär übertragen (siehe hier). In der Praxis diente dieser Schritt vor allem einer einheitlicheren Überwachung und Koordination, während die Boote auf See weiterhin von der zivilen UK Border Force angehalten und ihre Passagier_innen an die britische Küste gebracht wurden. Auch sollte erreicht werden, dass keine Boote unentdeckt anlandeten, seither ist dies auch nur in einem Fall dokumentiert worden. Frühzeitig hatte das Militär zu erkennen gegeben, dass es aufgrund der Bauweise der Marineschiffe keine Boote abfangen könne und auch keine Pushbacks durchführen werde. Im Sommer 2022 zeichnete sich ab, dass die militärischen Stellen die Operation Isotrope als eine unnötige Belastung ihrer Kapazitäten ansahen (siehe hier), die Regierung jedoch vor einer Beendigung der Operation zurückschreckte, weil sie ein falsches Signal an Migrannt_innen oder Schleuser_innen fürchtete. Dennoch sollte die Operation Isotrope zunächst zum Jahreswechel enden und wird nach aktuellem Stand nun am 1. Februar 2023 auslaufen.
Das von Sunak angekündigte Zentrum resultiert aus der Notwendigkeit, eine Nachfolgestruktur für die Operation Isotrope zu schaffen, in der weiterhin zivile mit militärischen Kapazitäten verzahnt werden können.
Sunak kündigte außerdem neue Gesetzesinitiativen an. Am 4. Januar erklärte er vor dem House of Commons: „Das Wichtigste, was wir tun müssen, ist, neue Gesetze zu verabschieden, und wir wollen sicherstellen, dass diese neuen Gesetze bedeuten, dass niemand, der illegal in unser Land kommt, bleiben kann. Sie werden in Gewahrsam genommen und schnell in ein sicheres Land oder in ihre Heimat zurückgeschickt, wenn dies angemessen ist.“ Mit dem Nationality and Borders Act ist seit mehr als einem halben Jahr bereits ein Gesetz in Kraft, dass genau diese Zielsetzung verfolgt (siehe hier), bislang jedoch nicht den von der Regierung erhofften Erfolg zeitigt.
„Nach dem Nationality and Borders Act ist es für Migranten illegal, wissentlich ohne Visum oder Sondergenehmigung in das Vereinigte Königreich einzureisen“, analysierte BBC: „Illegal eingereisten Personen drohen vier Jahre Gefängnis und die Abschiebung in ein sicheres Land, allerdings wurden weniger als 100 Personen, die zwischen dem 28. Juni und Mitte November einreisten, verhaftet. Trotz des Gesetzes ist das Vereinigte Königreich nach internationalem Recht verpflichtet, niemanden, der als Flüchtling Schutz sucht, strafrechtlich zu bestrafen.“
In einer ähnlichen Lage befindet sich die Regierung bei der Umsetzung des im April 2022 geschlossenen Abkommens mit Ruanda, das die zwangsweise Deportation von Channel migrants ermöglichen soll, wofür Ruanda im Gegenzug erhebliche Geldsummen erhält (siehe hier und hier). Wie ihre Amtsvorgängerin Priti Patel, hat Innenministerin Suella Braverman dem Vorhaben eine enorme symbolpolitische Bedeutung zugewiesen und es zu einem Prestigeprojekt ihrer Amtsführung gemacht. Trotz massiver Einspüche des UNHCR und zahlreicher anderer Akteure inszeniert Braverman es als wegweisenden Neuansatz der internationalen Flüchtlingspolitik, dem weitere Abkommen folgen würden. Sie selbst erscheint in diesem Framing als konservative Avantgarde und – bezogen auf rechtstaatliche und menschenrechtliche Normen – als Tabubrecherin.
Trotz einer für die Regierung bedingt positiven Entscheidung des High Court am 19. November 2022 (siehe hier) hat bislang kein Deportationsflug stattgefunden. Es ist nicht absehbar, wann dies geschehen wird und ob Deportationen nach Ruanda überhaupt in dem von Bravermann suggerierten Umfang und Tempo möglich sind.
Vor diesem Hintergrund erscheinen Sunaks Ankündigungen brüchig, denn sie zielen vielfach vor allem auf die Behebung bestehender Schwachstellen des Systems. Dies gilt etwa für seine Vorschläge, den stark angewachsenen Rückstau bei der Bearbeitung von Asylanträgen, den strukturell bedingten Mangel an Unterkünften und die daraus resultierenden Kosten durch Unterbringungen in Hotels – ein Standardthema der Boulevardmedien und antimigrantischen Aktivist_innen – zu beheben.
Indem aber die Schere zwischen konservativer Verheißung und migratorischer Realität auseinanderklafft, vergrößert sich der politische Spielraum, um im Vorfeld des Wahlkampfes besonders radikale Vorstöße platzieren zu können. Ein Vorgeschmack sind Spekulationen über die Wiedereinführung des Detained Fast Track, eines 2015 beendeten Verfahrens zur Abwicklung von Schnellverfahren bei gleichzeitiger Inhaftierung.
Wenn Sunak nun davon spricht, die Bootspassagen tatsächlich zu „stoppen“, ist dies offensichtlich realitätsfern. Ihm dürfte dies bewusst sein, worauf seine Weigerung hindeutet, den Zeitraum hierfür zu benennen. Trotz Operation Isotrope, Nationality and Borders Act, Ruanda-Deal und einer vierzigprozentigen Aufstockung der Patrouillen an der nordfranzösischen Küste ist die Zahl der erfolgreichen Bootspassagen von über 28.000 im Jahr 2021 auf knapp 46.000 im Jahr 2022 angestiegen (siehe hier). Die Aufnahme der Schlauchboote unter die fünf Top-Prioritäten der Regierung Sunak dürfte also nicht erfolgt sein, weil sie ein realistisches politisches Projekt darstellt, sondern weil sich die konservative Partei, die momentan keine Mehrheit der Wähler_innen für sich gewinnen würde, von der Mobilisierung des rechten Randes bessere Chancen für den Machterhalt verspricht. Ihre Motivation ist damit weniger eine innenpolitische, als eine parteipolitische.
Blaupause einer ultrarechten Agenda
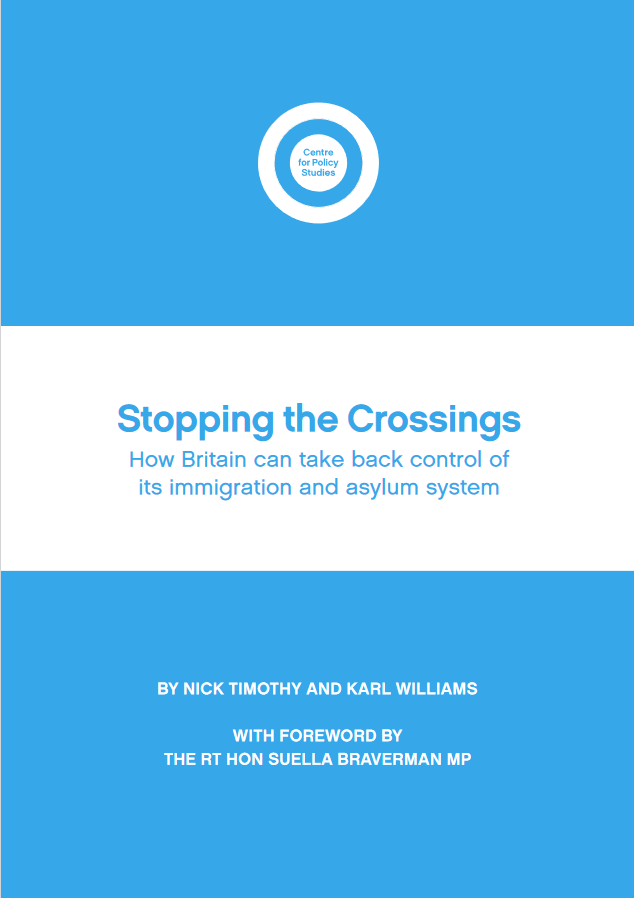
Wenige Wochen vor Sunaks Ankündigungen stellte der konservative Thinktank Centre for Policy Studies das Strategiepapier Stopping the Crossings ins Netz.
Das Papier umreisst ein Grenz- und Migrationsregime, das die restriktivsten Ansätze der Regierungen May, Johnson, Truss und Sunak aufgreift und radikalisiert: Das Abkommen mit Ruanda soll um Abkommen mit mindestens zwei weiteren Staaten oder britischen Überseegebieten erweitert werden. Dies soll die Deportation mehrerer zehntausend Menschen jährlich ermöglichen. Wer auf illegalisierte Weise aus einem EU-Staat nach Großbritannien einreist, soll nicht nur aus dem Asylsystem herausfallen, wie es im Nationality and Borders Act bereits vorgesehen ist. Das Asylsystem soll vielmehr ganz abgeschafft und durch ein System von Resettlements ersetzt werden, das nur bestimmten Gruppen – etwa Geflüchteten aus der Ukraine oder Bürger_innen von Hongkong – eine Einreise erlaubt. Auch für sie soll eine Obergrenze von nicht mehr als 20.000 pro Jahr gelten. Die regelmäßige Anpassung der Obergrenze durch das Parlement soll, so heißt es explizit, eine nicht abreißende Migrationsdebatte entstehen lassen. Die Unterbringung in lagerartigen Einrichtungen sollte zur Norm für ‚illegal‘ eingereiste oder auf ihre Deportation nach Ruanda etc. wartende Menschen werden. Als Vorbild nennt das Papier die Napier Barracks. Diese Anlage war Anfang 2021 wegen eklatanter Verstöße gegen humanitäre und menschenrechtliche Standards, einem Corona-Ausbruch, massiver Proteste, Suizidversuche und einen Großbrand landesweit zum Skandal geworden (siehe hier).
Diese Beispiele ließen sich fortsetzen. Sie verdeutlichen in erster Linie das Interesse der Autoren an einer weiteren Verschiebung der migrationspolitischen Debatte nach Rechts. Es verwundert daher kaum, unter den Quellen Artikel der Boulevardpresse und eine Vielzahl von Beiträgen des rechtsgerichteten Projekts Migration Watch UK zu finden. Ausdrücklich danken die Autoren dessen Vorsitzendem, dem früheren Diplomaten Alp Mehmet.
„Wenn wir unser Einwanderungs- und Asylsystem auf dieser Grundlage radikal umgestalten würden, hätten wir ein System, das umfassend auf Kontrolle und Abschreckung von Migranten von der illegalen Einreise in das Vereinigte Königreich [setzt],“ verspricht das Papier, für das Innenministerin Suella Braverman ein ausführliches Vorwort verfasst hat. Sie schreibt: „Und wir haben genug vom ständigen Missbrauch der Menschenrechtsgesetze, um die Abschiebung von Menschen zu vereiteln, die kein Recht haben, sich im Vereinigten Königreich aufzuhalten. Das muss ein Ende haben. Dies zu sagen ist nicht fremdenfeindlich oder einwanderungsfeindlich. Es ist die Realität, die von der großen Mehrheit der britischen Öffentlichkeit. Wer etwas anderes behauptet, beleidigt sie.“
Es ist ein Papier, das Anschluss an die migrationspolitischen Vorstellungen eines Orban oder einer Meloni sucht. Für das Verständnis der Post-Brexit-Grenzpolitik erscheint es elementar, sich dieses ideologische Mindset der Akteure bewusst zu machen. Das Papier buchstabiert dies auf vermeintlich wissenschaftliche Art aus und bietet der Regierung letztlich eine Blaupause für eine antimigrantische Kampagne an.
Das britische Abkommen mit Ruanda und seine imaginierten Folgeabkommen repräsentieren dieses ideologische Setting wie zur Zeit kein anderes Vorhaben der britischen Regierung. Zugleich entkoppelt es einen Teil der Grenzpolitik von der Zusammenarbeit mit Frankreich und anderen europäischen Staaten, ja von der Kanalregion überhaupt. Migrationspolitisches Handeln verwandelt sich in einen globalen Markt für Deals mit beliebigen Staaten, die gegen Bezahlung unerwünschte Migrant_innen übernehmen und dauerhaft vom Ziel ihrer Migration fernhalten. Damit erzeugt es Abschreckung und ein für manche nicht mehr erträgliches Maß an Verzweiflung (siehe hier), beinhaltet aber keinen Ansatz, um die Situation in der Kanalregion unmittelbar zu beeinflussen. Doch auch dort verändert sich die Art und Weise, wie Grenzpolitik zwischenstaatlich verhandelt wird.
Multilaterialisierung des Grenzregimes
Die britische Grenzpolitik in der Kanalregion basiert notwendigerweise auf der bilateralen Zusammenarbeit mit Frankreich, die seit 1986 in mehreren Verträgen geregelt ist und einmal jährlich durch neue Vereinbarungen aktualisiert wird. Auf dieser Basis ist ein komplexes Grenzregime entstanden, das die Kontrolle der britischen Grenze auf französisches Territorium vorverlagert, dort eine Sicherheitsarchitektur installiert und die Geflüchteten in einer feindseligen Umgebung blockiert, bei der es sich letztlich um eine menschengemachte humanitäre Krise handelt. Hinzu kommen gemeinsame Gremien und Dienststellen zur Erstellung von Lagebildern und zur Kooperation bei Ermittlungen und Strafverfahren gegen Schleuser_innen. Die Abkommen regeln im Kern die Finanzierung dieser Strukturen durch Großbritannien.
Waren diese Vereinbarungen lange Zeit so etwas wie der Motor der bilateralen Grenzpolitik, so ist dies momentan nicht mehr der Fall. Die aktuelle britisch-französische Vereinbarung vom 14. November 2022 beschränkt sich im Wesentlichen auf die Fortführung der bestehenden Strukturen und Finanzierungen. Bestehende Projekte werden teils ausgeweitet, teils aber auch auf Eis gelegt (siehe hier). In diesen Kontext gehören die Aufstockung der französischen Patrouillen um 40 % und im Dezember begonnene Hospitation britischer Beamt_innen. Vor dem britischen Parlament bezog sich Sunak hierauf, als er über das Stoppen der Boote redete. Solche Aufstockungen sind aber seit Jahren immer wieder erfolgt und sie sind weit davon entfernt, als game changer zu wirken.
Was sich auf dieser Ebene tatsächlich neu herausbildet, ist die multilateriale Zusammenarbeit auf Ministerebene mit Belgien, Niederlande und Deutschland: das sogenannte Calais-Format. Während Belgien und in geringerem Maße die Niederlande bereits in der Vergangenheit in die britisch-französische Kooperation eingebunden waren, ist dies bei Deutschland nun erstmals der Fall.
Ein erstes Treffen der Innenminister_innen dieser fünf Staaten war Ende 2021 in Calais vorgesehen, fand wegen eines diplomatischen Streits um die Bekämpfung der Bootspassagen jedoch ohne britische Teilnahme statt (siehe hier). Zum ersten Mal traf sich die Gesamtgruppe nun am 8. Dezember 2022 in Brüssel, außerdem nahmen Vertreter_innen von Frontex und Europol teil. Im Mittelpunkt standen die Verhinderung der innereuropäischen Sekundärmigration in die Kanalregion und die Bekämpfung der Schleuser_innen im Hinterland, insbesondere der Antransport der small boats aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden.
Auch verständigten sich die Minister_innen darauf, den Abschluss eines Vertrags zwischen der EU und Großbritannien zu unterstützen. Er soll die Lücke schließen, die mit dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU und damit auch aus dem Dublin-System für innereuropäische Abschiebungen entstanden ist. Ein solcher Vertrag wird von London seit langem eingefordert, doch haben bislang nicht einmal offizielle Verhandlungen zur Ausarbeitung eines Vertragsentwurfs begonnen.
Alles in allem können wir feststellen, dass das Grenzregime heute auf mehr Ebenen ausgehandelt und organisiert wird, als dies noch vor wenigen Jahren der Fall war. Neben der britisch-französische Kooperation, die sich nach wie vor auf die Sekuritisierung der Kanalregion konzentriert, bildet sich ein neues multilaterales Forum unter Einbeziehung Deutschlands sowie auf mittlere Sicht vielleicht auch ein migrationspolitisches Vertragswerk mit der EU heraus. Gleichzeitig strebt die britische Regierung obskure Deals nach dem Vorbild des Ruanda-Abkommens an, um sich als Avantgarde einer neuen internationalen Flüchtlingspolitik zu inszenieren. Die Grenzpolitik in Bezug auf dem Ärmelkanal wird auf dieser Ebene nicht nur rechter, sondern zugleich ideologischer und irrationaler.
Möglicherweise wird Großbritannien bald in einem Atemzug mit dem Ungarn Orbans und dem Italien Melonis genannt werden. Und während all dies geschieht, werden die Boote nicht stoppen.