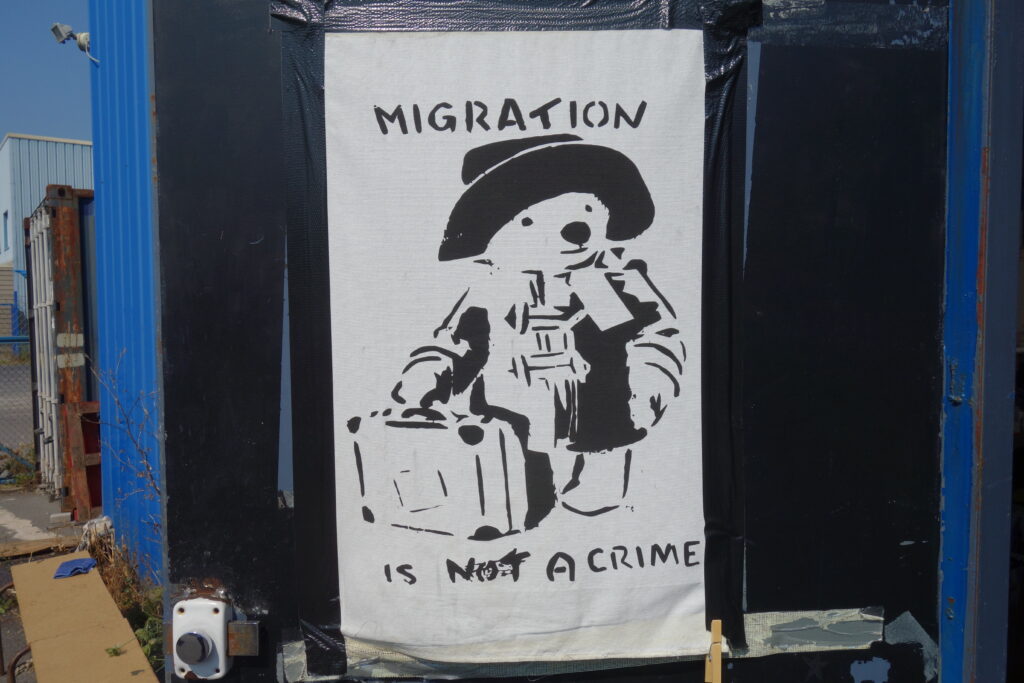
Die britische Politik gegenüber den small boats im Ärmelkanal durchläuft eine Veränderung. Diese vollzieht sich auf mehreren Handlungsebenen und weist zwei scheinbar entgegengesetzte Enwicklungslinien auf: Während einerseits neue multilaterale Formate unter Einbeziehung Deutschlands entstehen, tritt andererseits ein Primat des Nationalen hervor, das die Vielzahl einzelner Praktiken und Vorhaben ideologisch überwölbt. Die Post-Brexit-Grenzpolitik scheint sich in ihrer Radikalität den Grenzpolitiken von Staaten wie Ungarn, Italien oder Polen anzunähern. Dabei inszenieren sich britische Konservative mit eigenständigen Ideen als Avantgarde einer neuen internationalen Flüchtlingspolitik. Ob dies gelingen kann, ist alles andere als ausgemacht. In einer losen Folge von Beiträgen werden wir an dieser Stelle einige Dimensionen dieser Post-Brexit-Grenzpolitik ausleuchten. Wir beginnen mit einen Überblick.

