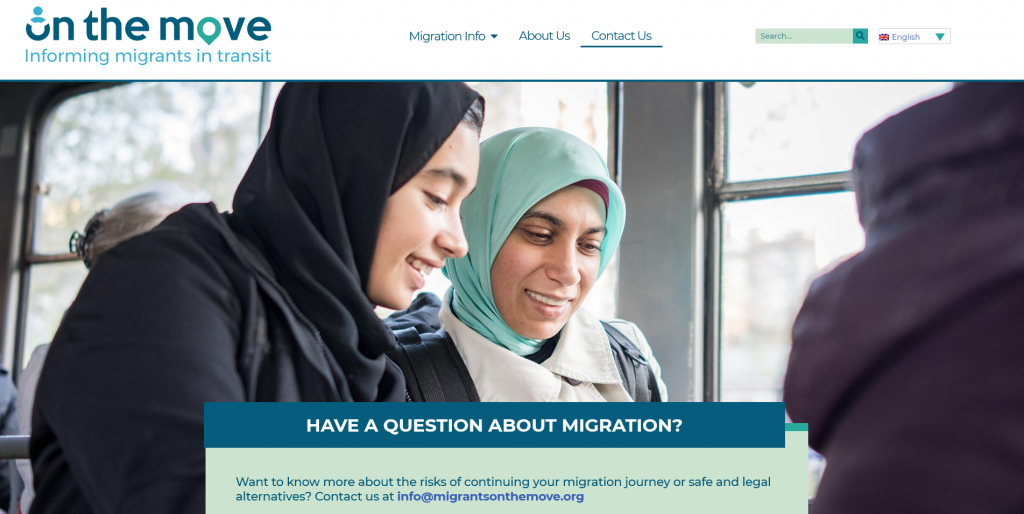Nach der Havarie, durch die am 12. August ein Bootspassagier starb (siehe hier), wurden nun einige Details über das Unglück und über den Umgang mit den Geretteten bekannt: Bei dem Opfer handelte es sich um einen 27jährigen Mann aus Eritrea. Bestätigt haben sich die am Tag des Unglücks veröffentlichten Meldungen über den Ablauf der Rettungsaktion. Allerdings veröffentlichte die Organisation Utopia 56 Schilderungen über den Umgang mit den Geretteten, die der behördlichen Darstellung widersprechen, man habe sich um die Menschen gekümmert.